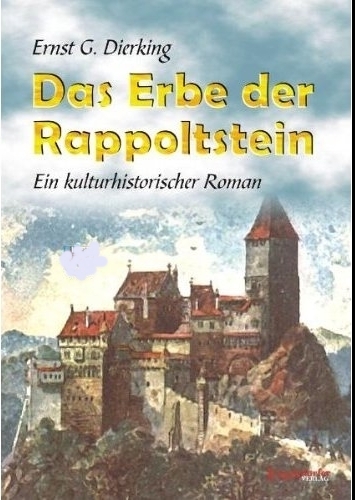
VORWORT
Wenn man den Begriff Gitanes hört, denkt man unwillkürlich an eine französische Zigarettenmarke, an dunklen Tabak und an Kreislaufstörungen.
Aber wer hätte es gewusst? Im Plural bedeutet Gitanes: „Die Zigeunerin“. Schön, dunkelhaarig, temperamentvoll und voller Magie.
Wenn in den folgenden Seiten von Zigeunern und Zigeunerinnen die Rede sein wird, so ist damit das temperamentvolle, feurige und magische Wesen dieser Menschen gemeint.
Keineswegs ist das Wort „Zigeuner“ ein Eigenname für eine ethnische Zugehörigkeit der Sinti und Roma. Das griechische Wort, „atsínganoi“ bedeutet: „Die Unberührbaren“.
Dalit ist die Selbstbezeichnung der Nachfahren der indischen Ureinwohner, die aus rassistischen Gründen als – Unberührbare – aus dem Kastensystem der kriegerischen indoarischen Einwanderer bzw. Eroberer, bis heute oft ausgeschlossen sind.
Der Begriff entwickelte sich aus dem Sanskritwort, dal; er wird übersetzt mit, zerbrochen, zerrissen, zerdrückt, vertrieben, niedergetreten, zerstört und Der-Zur-Schau-Gestellte. (Quelle: Wikipedia)
In Deutschland wurde der Begriff „Zigeuner“ seit dem Mittelalter, als Schimpfname benutzt, und als „umherziehende Gauner“ interpretiert.
Aber lassen wir diesen „Hokuspokus“ des Mittelalters. Denn auch der Begriff Hokuspokus wurde einst von unklugen Leuten umgedeutet und meint in Wahrheit „hoc est corpus“, der Leib Christi.
Die folgende Geschichte erzählt von einem fahrenden Volk, das zerbrochen, zerrissen, zerdrückt, vertrieben, niedergetreten, zerstört und zur Schau gestellt war.
Erst eine Lehenserbgift aus dem Mittelalter rettete sie aus dieser Situation. Zuguterletzt wurde eine ruhelos umherziehende Familie sesshaft und in den Adelsstand erhoben.
Ausgenommen des originalen Namens „Rappoltstein“, einem ausgestorbenen Adelsgeschlecht aus dem Mittelalter, sind alle anderen Namen von handelnden Personen, vom Autor frei erfunden. Ähnlichkeiten mit heute lebenden Personen sind rein zufällig.
1. Kapitel
Es ist Spätsommer des Jahres 1951, als sich eine Verschwörung über den Köpfen der Familie Wittich zusammenbraute. Nichtsahnend, dass man ihn und seine Familie seit einiger Zeit beobachtete, fährt Ludolf die unbefestigte Uferstraße entlang. Der Weg glich an dieser Stelle eher einem ausgefahrenen Feldweg, denn einer Straße.
Pappelbäume und die dazwischen wachsenden Sträucher wechselten das Bild der Moselauen immer wieder von neuem ab. Die Weinberge schickten ihr saftiges Grün von den Hängen herab und spiegelte sich im flachen Wasser der Mosel. Ein idyllischer Anblick, der einem Naturliebhaber das Herz in der Brust hätte höher schlagen lassen. Doch dafür hat Ludolf Wittich im Moment keinen Blick übrig. Seine Zigarre im rechten Mundwinkel richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf den ausgefahrenen und matschigen Feldweg vor ihm, um nicht mit dem Gespann in den Spurrillen auszugleiten und im nächsten Augenblick einen Achsbruch zu riskieren. Immer wieder kam das Fuhrwerk auf dem durchnässten Untergrund ins Schlingern und der Anhänger hinten drohte umzukippen. Doch Ludolf war ein erfahrener Pferdelenker und hielt das Gespann fest in der Spur.
Unbemerkt folgte ihnen seit geraumer Zeit ein Mann auf einem klapprigen Fahrrad. Von Zeit zu Zeit bleibt der Fremde halten, um dem langsam vorausfahrenden Fuhrwerk nicht zu nahe zu kommen.
Von diesem Verfolger bemerkte Ludolf nichts, zumal jener sich stets im Windschatten des Gespanns aufhielt und jede Wegbiegung ausnutzte, um nicht entdeckt zu werden.
Dennoch wurde der Fremde beobachtet, nämlich von Emma, der jüngsten Tochter der Wittichs. Diese saß mit ihrer Schwester im hinteren Wagen und blickte durch das rückwärtige Fenster.
Wegen des Nieselregens und der beschlagenen Fensterscheibe konnte sie den Mann auf dem Fahrrad nur schemenhaft erkennen und sah nur, dass dieser des Öfteren mit dem Fahrrad anhalten blieb. Was treibt einen Menschen bei diesem Wetter auf die Straße, fragte sie sich?
„Schau mal Maria, da fährt jemand mit dem Fahrrad hinter uns her!“
„Dann will ich nur hoffen, dass er bei diesem Regen auf dem Matschweg nicht ausrutscht und auf die Nase fällt! Wie kann man bei so einem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sein?“
Sie schüttelte verständnislos mit dem Kopf und häkelte, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken, an der angefangenen Tischdecke weiter.
„Ich bin wirklich froh, wenn wir bald wieder festen Boden unter den Rädern haben!“, sagte Emma.
„Wir sind ja bald in der Stadt, liebste Schwester!“
Emma setzte sich auf einen der Kisten und fragt:
„Wo fahren wir denn genau hin, hat Vater was gesagt?“
„Ich weiß es auch nicht, ins Französische hinein glaube ich!“
„Nach Ribeauvillè vielleicht?“, fragte Emma schnell.
„Ich weiß es nicht!“, antwortete Maria. „Aber was reizt dich so sehr an Ribeauvillè?“ Maria blickte fragend von ihrer Arbeit auf.
„Ach nichts Besonderes! Ich erinnere mich nur an diese Stadt noch vom letzten Jahr. Dort war es sehr schön!“
Maria legte ihre Häkelsachen beiseite, stand von ihrer Holzbank auf und blickte durch das Heckfenster. Von dem Fahrradfahrer war nichts mehr zu sehen.
„Der Radfahrer scheint irgendwo abgebogen zu sein!“ Sagte sie und setzte sich wieder auf die Bank, nahm die Blechkanne vom Tisch und schenkte sich und ihrer Schwester kalten Tee in ihre Becher.
Die Einzigen, die das Ziel ihrer Reise kannten waren Ludolf, dessen Frau Hedewig und die beiden Großeltern Notburga und Opa Gunther. Die Letztgenannten saßen zusammen mit Sohn Wilhelm im Wohnwagen und spielten zum Zeitvertreib „Mensch ärgere dich nicht“..
„Ob wohl heute noch die Sonne herauskommt?“, fragte Notburga.
„Das will ich doch sehr hoffen!“, erklärt Hedewig und blickte durch das seitliche Fenster. „Wir werden wohl heute doch noch einige Töpfe und Pfannen verkaufen können!“, meinte sie dann, als sie wieder dem Tisch zugewandt war.
„Frag doch mal am Besten deine Tarotkarten, Oma!“, sagte Wilhelm lästernd zu Notburga, würfelte eine Sechs und schmiss Opa Gunther vom roten Startfeld.
„Mit euch macht das Spielen keinen Spaß, ich gehe lieber nach draußen und leiste Ludolf etwas Gesellschaft!“ Opa stand von seiner Bank auf, öffnete die Tür zum Kutschbock und sagte: „Rutsch mal ein Stück rüber, mein Sohn!“ Gunther setzte sich neben Ludolf auf den Bock und legte sich eine Pferdedecke über die Knie.
„Na Großvater, hat Wilhelm mal wieder gewonnen?“
„Ja, der Knilch schummelt beim Würfeln. Das hat er wohl von dir geerbt!“ Frotzelte Opa Gunther.
Ohne auf die Frotzelei seines Vaters einzugehen, lenkte Ludolf das Gespann einen leichten Abhang hinunter, wo er unten verschiedene Wegweiser vorfand. Dort las er auf verwitterten Schildern die Hinweise: Schweich – Föhren – Trier. Darunter stand auf einem Extraschild: „Route de Paris.“ Sein nächstes Ziel war jedoch die Kleinstadt Trier an der Mosel, eine alte Garnisonsstadt aus der Römerzeit.
„Wir sind auf dem richtigen Weg!“, meinte Ludolf zu Opa und deutet auf das Hinweisschild.
„Wir sind immer auf dem richtigen Weg!“, antwortet Opa lakonisch. „Wir fahren stets irgendwo hin und fahren auch wieder weg, nur ankommen tun wir nie!"...
„Zigeuner?“, wurde überall gefragt. Fenster gehen auf und man hörte warnende Rufe: „Ja, es sind Zigeuner in der Stadt, macht schnell die Fensterläden dicht und nehmt die Wäsche von der Leine!“
Die Wäsche von der Leine? Wer hängt denn bei so einem Wetter seine Wäsche auf die Leine? Fragte sich Ludolf und schüttelte verständnislos mit dem Kopf.
Er wusste aus Erfahrung, dass die Leute es eigentlich gar nicht böse meinten, wenn sie bei ihnen von Zigeunern sprachen. Dieses Szenario kannten er und seine Familie ja fast nun von jeder Stadt, in der sie mit ihrem nostalgischen Gefährt auftauchten.
Die Nachricht, dass die Zigeuner in der Stadt seinen, verbreitete sich rasend schnell und an den Bürgersteigen versammelten sich bereits die ersten neugierigen Gaffer.
„Das sind keine Zigeuner“, hörte man eine ältere Dame dazwischen rufen, die zufällig des Weges kam. „Das sind die Wittichs, die kenne ich! Das sind ehrbare Fahrensleuteleute, aus der Sippe der Jenischen!“
„Jenisch, Jenische ..., was sind das für Leute?“ Fragend sehen sich einige Passanten an. Der Begriff – jenisch – war ihnen bisher noch nie zu Ohren gekommen.
Da drängt sich ein Mann mit Schlapphut durch die Zuschauermenge und ruft: „Ich kenne diese Jenischen, das sind keine Zigeuner, aber Gauner, Bettler und Strauchdiebe, ohne festen Wohnsitz. Die streunen überall herum und klauen, wo sie nur können, diesen Leuten darf man nicht über den Weg trauen!“
Ludolf wurde leicht rot im Gesicht, und brachte das Gespann zum halten. Er wollte sich gerade dem Sprecher zuwenden, als die ältere Dame auf ihn zukommt und sagt:
„Hören Sie nicht darauf, Herr Wittich, was der Mann da sagt, ich kenne Sie besser. Mein Mann hat mir viel von Ihnen erzählt und er wusste nur Gutes über Sie und ihre Familie zu berichten!“ Das sagte sie sehr laut, sodass alle Umstehenden es hören konnten.
Dankend winkt Ludolf der älteren Frau zu, die ihn zu kennen schien. Als sie näher kam, erkannte er in ihr die alte Dame vom letzten Jahr wieder.
„Ach Sie sind`s, Frau Lauer! Ich danke Ihnen für ihre Fürsprache, wie geht es Ihnen?“ Ludolf reichte der alten Dame die Hand vom Kutschbock herunter und nahm dabei seine Kappe vom Kopf.
„Geht es ihrem Mann wieder gut, er war doch so krank im letzen Jahr?“
„Mein Hubert ist leider vor vier Monaten verstorben, Herr Wittich!“ Antwortet diese und stützte sich neben dem Fuhrwerk auf ihren Krückstock.
„Das tut mir aber sehr leid, verehrte Frau Lauer! Was machen Sie denn nun ohne ihren Mann?“
„Ich habe leider nur eine kleine Witwenrente und dem, was die Leute mir hin und wieder aus ihrem Garten zukommen lassen!“
„Hm!“, machte Ludolf und schien zu überlegen.
Als Ludolf seinen Blick wieder hob, um in die Menschenmenge zu blicken, war der Fremde mit Schlapphut verschwunden. Leider hatte er ihn nicht genau betrachtet, um ihn später wiedererkennen zu können.
Dann wandte er sich vom Kutschbock herunter an die umstehende Menge:
„Hört Leute! Ihr könnt heute ausnahmsweise euere Messer und Scheren zum Sonderpreis bei mir schleifen lassen. Töpfe und Pfannen gibt es auch zum Sonderpreis. Einen Teil des Geldes erhält dann die Witwe Lauer von mir. Ihr findet uns also nachher auf dem Viehmarkt!“
Ludolf verabschiedete sich von der alten Dame, ergriff die Zügel und fuhr im Schritttempo weiter.
„Übrigens“, ruft er den Leuten im Vorbeifahren zu, „das fahrende Volk sind auch Menschen, und zwar nicht die Schlechtesten!“
Die Wittichs waren keine Zigeuner, sondern eine alte germanische Fahrensfamilie, deren Wurzeln bis tief ins Mittelalter zurückreichten. Doch wurden sie von der Bevölkerung stets als Zigeuner betrachtet, da diese, ähnlich den Sinti und Roma, Unständige waren und keinen festen Wohnsitz hatten.
Wer wusste schon um die Geschichte und dem Schicksal einzelner deutscher Fahrensfamilien, die nach den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs 1618 – 1648 heimatlos geworden und entwurzelt waren?
Die Wittichs waren sogar Abkömmlinge eines der ältesten Familienclans, die schon zur Zeit Kaiser Ferdinands III. 1431, als Pfeifer und Minnesänger, das Recht als freie Fahrensleute zuerkannt bekamen. Eine alte Urkunde aus jener Zeit, die sie als einziges Erbe mit sich führten, bewies dies.
An die Geschichte seiner Familie musste Ludolf gerade denken, als er mit dem Fuhrwerk in Richtung Viehmarkt fuhr. Es war ihm doch nicht so ganz egal, wenn man ihn und seine Familie immer wieder als umherziehende Vagabunden und Zigeuner beschimpfte. Aus diesem Grunde sehnte er sich samt seiner Familie nach einem Ruhepol, nach einem festen Wohnsitz.
Der Viehmarkt war bald erreicht und der mitgeführte Schleifstein schnell aufgebaut.
Einzelne Leute kamen bereits mit ihren Küchenmessern, Scheren und Sicheln hinter dem Fahrzeug her, um diese zum Sonderpreis schleifen zu lassen. Nicht zuletzt, um damit der alten Frau Lauer zu helfen.
Bald hörte man auf dem Viehmarkt das regelmäßige Sirren des Schleifsteins. Ludolf Wittich saß dort auf einem Schemel und taucht bereits ein Messer nach dem anderen in einen bereitgestellten Blecheimer mit Wasser. Daneben stand sein Sohn Wilhelm, der fleißig an der Kurbel drehte, damit der Stein ständig in Schwung blieb.
„So, gnädige Frau, dieses Messer ist wieder so scharf, damit können Sie den Bart Ihres Mannes rasieren!“
Zum Beweis zog er das Messer durch eine alte Zeitung.
„Mein Mann ist im Krieg gefallen, welchen Bart soll ich da noch abschneiden?“ fragte die Frau, welcher das Messer gehörte.
„Das tut mir leid!“, antwortet Ludolf etwas beschämt über seine unbedachte Äußerung und gab ihr das Messer mit den Worten zurück: „Entschuldigen Sie bitte, das wusste ich nicht!“
„Mache Sie sich keine Gedanken, der Herr!“ Die Frau nahm das geschliffene Messer, bezahlte die verlangten Groschen und ging.
„Was kostet denn jetzt das Schleifen von Messern?“, meldete sich eine andere Frau, die scheinbar mehrere stumpfe Messer zum Schleifenlassen mitgebracht hatte.
„Heute kostet das Schleifen nur ein Groschen pro Messer!“
„Einen Groschen? Das ist aber wirklich günstig! Ich habe auch nur eine kleine Witwenrente, wie die Frau Lauer. Mein Mann ist ebenfalls im letzten Krieg gefallen.
Hier habe ich noch zwei Messer und eine alte Schneiderschere. Wissen Sie, ich verdiene mir ein paar Mark im Monat durch Nähen und Änderungsschneiderei hinzu.
Was kostet das Schleifen der Schere?“ Sie holt die besagten Gegenstände aus ihrer Manteltasche und reichte sie Ludolf hin.
„Eine Schere schleifen zu lassen kostet normal fünfzig Pfennige, Madame! Von Ihnen aber nehme ich nur drei Groschen! Sind Sie damit einverstanden?“
„Also, einverstanden, hier gebe ich Ihnen eine Mark, davon ist ein Groschen für die Frau Lauer! Wissen Sie, die Lauer ist meine Nachbarin und hat mir viel von Ihnen erzählt.“
Mit diesen Worten legte sie Ludolf sechs stumpfe Messer und eine Schere in seine Lederschürze und drückte ihm das Geld in die Hand.
Ludolf steckte das Geld ein und sagte:
„So, so, die ehrenwerte Frau Lauer hat Ihnen von uns erzählt?“
„Ja, sie hat zu mir gesagt, dass man Messer bei den Zigeunern auch Schuri nennt!“
„Richtig, genau so nennt man das bei den Zigeunern!“ Antwortete Ludolf und hielt die Schneide des ersten Messers gegen das Licht, um es zu prüfen. Dann zog er die Messer nacheinander über den Schleifstein und kühlte sie danach im Wasser ab.
Nachdem die sechs Messer und Scheren geschliffen waren, drängten sich immer mehr Leute um ihn herum, einerseits um ihm beim Schleifen zuzusehen und andererseits, um ihre eigenen Messer schleifen zu lassen.
Ein halbwüchsiger Knabe in Lederhosen drängte sich vor, brachte sein Taschenmesser aus der Tasche zum Vorschein, und fragte:
„Kannst du mir mein Messer auch schleifen, Onkel? Ich habe aber kein Geld!“
„Komm her mein Junge, das schleife ich dir schnell umsonst!“ Damit nahm er dem Jungen das Messer aus der Hand und schliff es von beiden Seiten.
„So, hier hast du dein Messer wieder zurück, aber pass gut auf, dass du dich damit nicht selbst in den Finger schneidest!“
„Danke, Onkel!“, sagte der Junge und verschwand schnell in der Menge.
Diese Geste kam bei den Leuten sehr gut an und immer mehr kamen herzu, um ihre Messer schleifen zu lassen.
„Wo kommen Sie denn her?“, wurde Ludolf von einigen Leuten gefragt.
„Von überall und nirgends!“, gibt er zur Antwort. „Wie Sie sicherlich wissen, gehören wir zum fahrenden Volk und sind mal hier, mal dort. Fragen Sie einen Vogel, woher er kommt? Er kann es Ihnen auch nicht sagen!“
„Und wo fahren Sie als Nächstes hin?“, will ein Mann wissen.
„Wissen Sie der Herr, wenn ich das mal so sagen darf: Es ist immer besser seinen Weg zu verschweigen, damit einem die Gefahr nicht vorauseilt, verstehen Sie das?“ Mit diesen und ähnlichen Antworten mussten sich die Leute zufriedengeben...
Lange bevor sich die Wittichs auf den Weg gemacht hatten, stieg ein gewisser Marcel Poschinger am Hauptbahnhof von Trier in den Zug, um nach der französischen Kleinstadt Nancy zu fahren. Er hatte von Raoul erfahren, dass die Wittichs diese Strecke nehmen würden. Irgendwo zwischen Nancy und Straßburg wollte er dann mit Raoul wieder zusammentreffen.
Der Weg nach Frankreich führte Ludolf weiter am rechten Ufer die Mosel entlang. Er beabsichtigte, in etwa vier Stunden, die französische Grenze zu erreichen. Die Pferde waren in den frühen Morgenstunden noch frisch und ausgeruht. Daher spornte er sie zu einer schnelleren Gangart an, was jedoch wegen der Schwere des Gespanns nur Streckenweise möglich war. Die Straße folgte immer den Moselschleifen und war gut ausgebaut.
„Hoffentlich kann der Dinnelo da hinter uns, (Dinnelo bedeutet auf Jenisch: Depp oder Narr) mit uns Schritt halten“, sagt Ludolf zu seinem Sohn lakonisch, der neben ihm auf dem Kutschbock saß.. „Der Gaul von ihm sah mir nicht besonders gesund aus!“
„Das kann uns doch egal sein, Vater. Der findet seinen Weg auch allein. Ich traue dem Burschen da hinter uns ohnehin nicht über den Weg. Ich glaube, der stellt sich bloß so, als wäre er doof!“
„Wer in Frankreich als deutscher Landsmann, Wein verkaufen will, der ist doof, mein Sohn!“
Tatsächlich fiel Raoul mit seinem Einachser immer weiter zurück und konnte die Wittichs nur wieder einholen, sobald diese etwas langsamer fuhren.
„Ihr wollt mich wohl gerne loswerden?“ schimpfte er hämisch lachend vor sich hin. „Das könnte euch so passen, so leicht werdet ihr mich nicht los! Euere Wagen sind schwerer als der Meine, und vor der Grenze geht es bergauf. Haha!“ Raoul spukte verächtlich auf die Straße und gab dem Pferd die Zügel.
Er behielt recht, an manchen Stellen ging die Straße wirklich steil hinauf. Das verzögerte die Fahrt der Wittichs erheblich und Raoul holte wieder auf.
Viele kleine Ortschaften, idyllisch inmitten der Weinberge gelegen, säumen das rechte Moselufer.
Auf der anderen Seite der Mosel sahen sie das Fürstentum Luxemburg. Auch dort wurde das Ufer von Weinbergen und vielen kleineren Ortschaften gesäumt.
Beim Anblick der Dörfer juckte es Ludolf regelrecht in den Fingern anzuhalten, um dort seine Künste als Scherenschleifer und Kesselflicker erneut unter Beweis zu stellen. Hatte er doch gestern in der Stadt Trier soviel Geld damit verdient. Doch leider zwang ihn die knappe Zeit, die Ortschaften links liegen zu lassen.
In zwei, spätestens drei Tagen wollte man die Stadt Ribeauvillè, zu Deutsch Rappoldsweiler erreicht haben, um dort noch rechtzeitig einen Standplatz zu ergattern.
Ludolf beabsichtigte am diesjährigen legendären Pfifferfest von Ribeauvillè teilzunehmen, ein Fest, dass an die frühen Zünfte der Minnesänger und Pfeifer des Mittelalters erinnerte. Gleichzeitig hatte er eine Verabredung, in der Nähe von Ribeauvillè, mit einem Freund einer anderen Sippe. Er und seine Familie ahnten nicht, dass ihnen besondere Ereignisse und wichtige Begegnungen bevorstanden, die ihnen Aufschluss über ihre wahre Herkunft geben sollten und ihr Leben veränderten.
„Hüh!“ Erscholl Ludolfs Stimme durch die Landschaft. Die beiden starkknochige Haflinger zogen, den Zügeln Ludolfs folgend, die schweren Wagen, die inzwischen wieder holpriger gewordene Schotterstraße entlang. Das Fuhrwerk knirschte und ächzte, als drohe es in jeden Moment auseinanderzubrechen. Die Radnaben der Holzspeichenräder geben bei jeder Umdrehung ein quietschendes Geräusch von sich. Immer wieder muss Ludolf deswegen anhalten, um die trocken gelaufenen Radlager zu fetten.
„Wenn das so weiter geht, schaffen wir es nicht rechtzeitig bis Ribeauvillè!“, sagt er zu seiner Frau, die hinter ihm sitzend aus dem Wagenfenster schaute.
„Das schaffen wir schon!“, antwortet sie zuversichtlich.
„Wollen es hoffen!“, erwidert Ludolf. „Wenn der Wagen nicht so voll beladen wäre, kämen wir wesentlich schneller voran. Im übrigen muss ich ständig auf den Dinnelo (Narr) da hinter uns achten, sonst verpasst er den Weg noch nach Frankreich. Will im Land der Weine, Wein verkaufen. Dass ich nicht lache!“ Dieser Gedanke ließ Ludolf nicht mehr los.
Unauffällig beobachtete Raoul jede Bewegung der vor ihm fahrenden Familie, wobei ihm nicht entgangen war, dass Ludolf unterwegs des Öfteren anhalten musste, um die Radnaben zu fetten.
Maria und Wilhelm liefen inzwischen, gefolgt von ihrem ungarischen Hirtenhund Balduin, dem Gespann zu Fuß hinterher, und achteten darauf, dass keines der Gepäckstücke unterwegs verloren ging. Ab und zu blickten sie zurück, um sich zu vergewissern, ob der Fremde ihnen noch folgte.
Emma setzte sich zu ihrem Vater nach vorn und nahm ihm die Zügel aus der Hand.
„Lass mich fahren, Vater!“, sagte sie. Und so lenkte sie das Gespann, mit sicherer Hand, die befestigte Straße entlang.
„Das machst du gut, mein Kind!“, lobte er seine Tochter.
„Das hast du mir ja auch beigebracht, Papa!“, antwortet sie schelmisch, aber doch geschmeichelt über das Lob ihres Vaters.
„Ich hoffe, wir erreichen morgen abend Ribeauvillè!“
„Ribeauvillè?“, fragt Emma freudig überrascht. „Das, hoffe ich auch sehr, Vater!“, sagte sie gut gelaunt und mit leicht verklärter Stimme. „Du solltest übrigens keine große Rücksicht auf diesen Fremden da hinter uns nehmen. Er kann ja unserer Wagenspur folgen, um ins Elsass zu gelangen. Ich traue dem Mann sowieso nicht über den Weg.
„Du traust ihm also auch nicht?“
„Merkst du denn nicht, dass er uns die ganze Zeit unauffällig beobachtet, und wenn du wegen der Radnaben anhältst, hält er sich immer in gehöriger Entfernung, anstatt heranzukommen und zu fragen, ob er dir helfen kann. Irgendetwas hat der Gatsch da hinten zu verbergen, das spüre ich!“
„Er will uns halt nur nicht belästigen, wie er gesagt hat, zumal ich ihn gestern ziemlich barsch angefahren habe!“
„Nein, Vater, das ist es nicht. Er hat bestimmt irgendwas vor, ich kann das spüren! Der kam gestern auch nicht zufällig vorbei! Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Als wir gestern bei dem Regenwetter nach Trier fuhren, folgte uns ein Mann auf einem Fahrrad. Leider konnte ich den Mann nicht erkennen!“
Ludolf wurde hellhörig.
„Dann werden wir den Gatsch scharf im Auge behalten, mein Kind!“, antwortet Ludolf gelassen und nahm Emma die Zügel wieder aus der Hand.
Emma hatte Recht, der Fremde hielt mit Absicht einen gehörigen Abstand hinter den Wittichs. Seinen zerkrempelten Hut hatte er sich tief ins Gesicht gezogen, damit man seinen lauernden Blick nicht sehen konnte. Nervös kaute er auf einem Grashalm herum. Hoffentlich schafft es Marcel rechtzeitig vor Ort, zu sein?
Raoul wusste zwar nicht genau, wer dieser Marcel Poschinger in Wahrheit war und was er vorhatte, doch konnte es sich eigentlich nur um die Kasse und Handelswaren der Wittichs handeln. Er hatte ihn vor Kurzem in Trier in einer Spelunke kennen gelernt, und von ihm das Angebot gemacht bekommen, auf die Schnelle viel Geld zu verdienen. Und da er ohnehin pleite war, kam ihm dieses Angebot gelegen. Für Wagen und Pferd hatte dieser Poschinger bereits vorher gesorgt.
Da fragte Vater Ludolf seine Tochter Emma: „Warum hältst du den Gatsch hinter uns für einen Strauchdieb?“
„Der Mann hat böse Augen, Papa und einen sehr unruhigen Blick. Als er mich gestern in Trier anblickte, erschaudert es mich, und es lief mir eiskalt den Rücken herunter.
Als er dann behauptete, er wolle nach Frankreich, um dort auf den Märkten Geschäfte zu machen, so glaubten Maria und ich ihm das nicht. Maria und ich sind ihm heimlich hinterher gegangen und haben gesehen, wie er sich mit einem anderen Mann traf. Leider konnten wir ihre Unterhaltung nicht verstehen, weil wir uns zu weit zurückhielten, da sie uns sonst gesehen hätten. Doch Maria erklärte mir, dass sie anhand der Gebärden erraten habe, dass es dabei um uns gegangen sein muss. Hin und wieder deutete dieser Raoul mit seiner Hand in Richtung unserer Wagen und der andere Mann nickte darauf sehr heftig mit dem Kopf. Danach verschwanden sie zusammen in einer Kneipe!“
„Wir werden also aufpassen müssen, ob er etwas gegen uns im Schilde führt!“, antwortet Ludolf. „Und, wenn er etwas gegen uns im Schilde führen sollte, hetze ich ihm unseren Balduin auf den Hals. Der Hund scheint den Kerl ohnehin nicht zu mögen. Im übrigen sind dein Bruder Wilhelm und ich auch nicht von schlechten Eltern. Hinten im Wagen habe ich für solche Fälle einen Karabiner K 98 aus dem Ersten Weltkrieg versteckt. Also, keine Sorge liebe Emma, es sind genügend Augen, die aufpassen!“
Damit war ihre Unterhaltung beendet.
Nach vier Stunden erreichten sie die deutsch-französische Grenze. Bereits von Weitem sahen sie den Schlagbaum und das Schild Zoll – Douane. Die Zollformalitäten an der Grenze waren schnell erledigt, zumal die Zöllner die Sippe der Wittichs bereits von früheren Fahrten her kannten. Sie kontrollierten lediglich, ob zusätzlich fremde Personen auf dem Wagen waren. Nur bei Raoul durchsuchten sie dessen Wagen genauer, fanden jedoch nichts.
„Bon Route!“ Sagten die deutschen Zöllner und ließen den Wagentross die deutsche Seite passieren. Die gleichen Formalitäten erfolgten nochmals auf der französischen Seite und schon befand man sich auf der Route über Sierck-les-Bains - Thionville – Metz – nach Nancy. Von dort wollte man durch die Vogesen, in Richtung Colmar weiterfahren.
Die Fahrt über die vielen Dörfer ging nur schleppend und langsam voran. Nach achteinhalbstündiger Fahrt, unterwegs gab es keine besonderen Vorkommnisse, hatte man endlich Nancy erreicht.
Es begann bereits zu dunkeln, als man in Nancy ankam. Dennoch beabsichtigte Ludolf, die 35 Kilometer bis Lunéville weiterzufahren. Von seinem Schatten Raoul hatte er seit Langem nichts mehr gesehen. Mochte dieser Raoul nun bleiben, wo er wollte. Er hatte ihn bis ins Elsass mitgenommen, und das war sein einziges Versprechen.
So fuhr er dem Wegweiser folgend den langsam ansteigenden Weg in das Gebirge. Der Rest seiner Sippe schlief bereits im Wagen. Als es dann völlig zu dunkeln begann, zündete er die mitgeführten Karbidlampen an, hängte zwei nach vorne in die vorgesehene Halterung und befestigte eine hinten am Wagen. So folgte er bei dieser spärlichen Beleuchtung dem Waldweg, der sich vor ihm auftat. Vorsichtshalber hatte er bereits vorher den Karabiner aus dem Wagen geholt, den er nun geladen quer vor sich auf den Knien liegen hatte. Balduin lag vor ihm und beobachtete jede seiner Bewegungen...
„Diese Hunde!“, schimpft Raoul. „Dass sie ausgerechnet uns jetzt über den Weg fahren mussten! Wenn ich diesen jungen Zigeuner erwische, der mich mit meiner eigenen Peitsche geschlagen hat, zahle ich es ihm heim!“
„Komm mit!“, antwortete Marcel ihm nur, und geht ein Stück des Weges zurück. Nach einigen hundert Metern kommen sie bei einem halb verfallenem Haus an.
„Aubergè du Rhin“, Herberge am Rhein, prangt in verrotteten Lettern der Name dieses Etablissements von der Wand.
„Diese Herberge findet so schnell niemand, hier sind wir absolut sicher!“, erklärt Marcel seinem Spießgesellen Raoul.
Gemeinsam betreten sie die Gaststube. Eine Wolke beizender Zigarrenqualm kommt ihnen von dort entgegen. Die Stube ist in ein Halbdunkel gehüllt und an den Tischen sitzen verwahrloste Gestallten beim Wein und Kartenspiel. Es geht ziemlich lauthals zu und man merkt den Gästen an, dass sie nicht erst seit Kurzem dort sitzen. Diese Spelunke ist im wahrsten Sinne, eine Räuberhöhle.
Marcel und Raoul begeben sich zur hintersten Ecke und setzen sich dort an einen runden Tisch. Hier fühlen sie sich einigermaßen ungestört und können heimlich miteinander sprechen.
Nachdem die Wirtin nach ihrem Begehr gefragt hatte, bestellte jeder eine Flasche billigen Rouge. Als die Wirtin den verlangten Rotwein gebracht hatte, warfen sie ihr ein paar Centimes auf den Tisch und gaben ihr durch ein Handzeichen zu verstehen, dass sie nicht gestört sein wollten.
„Ich weiß jetzt, hinter welchem Dokument du her bist!“, eröffnet Raoul das Gespräch.
„Na, hinter welchem denn?“
„Hinter der Urkunde, über das Lehensrecht der Wittichs, dass sie im Mittelalter erhalten haben! Der Alte von den Wittichs besitzt nämlich so eine Urkunde, ich habe sie gesehen!“
„Soso, bist du da sicher?“
„Na klar doch, ich habe diese Zigeuner am Abend belauscht, als der Alte anfing auf seiner komischen Flöte zu spielen. Danach ist er in den Wagen gestiegen und brachte diese Urkunde mit heraus. Die alte Zicke, die mich beleidigt hatte, ich glaube Notburga wurde sie genannt, las sie dann laut vor. Ich konnte jedes Wort sehr genau verstehen!“
„Diese Urkunde, von der du sprichst, interessiert mich nicht! Doch ich dachte du wolltest an diesem Abend unbemerkt in den Wagen der Wittichs steigen, um nach Geld zu suchen?“
„Das hab ich auch versucht, doch dieser Köter lag auf der Lauer, dieses Mistvieh. Hätte mich beinahe erwischt!“
„Ich muss diese Urkunde unbedingt haben“, sprach Marcel halb zu sich selbst, „aber nicht die, die du meinst, die hat gar keinen Wert!“, sagte er zu Raoul. „Die Wittichs besitzen noch eine zweite Urkunde, die viel wertvoller ist, diese will ich haben!“
„Aha, welche den? Was steht denn da drin?
„Davon will ich jetzt nicht sprechen, nur soviel, sie ist sehr, sehr wertvoll!“
„Ach, und das sagst du mir jetzt erst?“
„Warum sollte ich mit dir darüber sprechen? Sie gehört doch mir!“
„Jetzt nicht mehr, jetzt gehört sie uns! Uns beiden, verstehst du?“, sagte da Raoul zu Marcel im bestimmenden Ton. Man konnte nun deutlich die Gier in Raouls Augen erkennen.
„Das denkst aber nur du! Du bekommst schon deinen Anteil, wie versprochen!“
Ja, wenn du mir aber nicht ehrlich sagst, was die Urkunde wert ist, muss ich davon ausgehen, dass sie viel mehr Wert hat als du mir verraten willst! Ich verhelfe dir schließlich dazu, dass du sie überhaupt bekommst! Ohne meine Hilfe bekämst du sie nicht. Also gehört sie uns beiden zu gleichen Teilen!“
Das Gespräch verlief von jetzt an ziemlich hitzig. Man konnte sich nicht darüber einig werden, wem die Urkunde gehört. In der Zwischenzeit hatten sie bereits die zweite Flasche Rotwein geleert.
Die Wirtin brachte unaufgefordert weiteren Wein an den Tisch und goss die Gläser randvoll, bis zum Überlaufen.
Da meinte Marcel mit leicht lallender Stimme zu Raoul: „Nun gut, du bist mein Freund, ich will dich in mein Geheimnis einweihen, aber zu keinem ein Wort!“
„Nun red doch endlich!“, forderte Raoul seinen Kumpan Marcel Poschinger auf und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche.
Marcel neigt sich zu Raoul hinüber und flüstert ihm ins Ohr:
„Diese Urkunde ist ein altes Erbstück, ein Pergament über eine Grundstücksschenkung. Sie wurde damals von einer gewissen Frau, ach wie hieß er doch gleich; von irgendeiner Gräfin halt, an die damalige Familie Wittich, ihres Zeichens hoheitliche Flötenspieler ausgestellt! Das Ding ist noch original von einem Kaiser unterzeichnet und mit seinem Siegel versehen! Jeder, der diese Urkunde besitzt, ist Eigentümer sehr großer Ländereien hier im Elsass!“
„Mensch, dann sind wir beide ja Reich!“, ruft Raoul voller Begeisterung laut.
„Schrei doch nicht so, es muss doch keiner wissen, und noch haben wir diese Urkunde noch nicht in Händen!“
„Die werden wir uns ganz sicher holen und wenn ich dieser Sippschaft alle die Hälse durchschneiden müsste!“, beteuert Raoul. Die Vorstellung bald Reich zu sein, ließ ihn alle Moral vergessen.
Daraufhin setzt er sich seine Weinflasche an den Hals und leert den Rest in einem Zug.
„Zwei Flaschen Rouge du Vin, tout de suite!“, ruft Raoul der Wirtin im Befehlston zu. Diese brachte auch sofort die bestellten Weinflaschen und stellt sie auf den Tisch.
„Sie können hier ruhig deutsch sprechen, Monsieur, meine Gäste kommen fast alle von der Rechten Seite des Rheins herüber. A la votre santè!“, sagte sie kurz und verschwand schnell wieder hinter ihrem Tresen.
Nachdem Raoul nun endlich wusste, um, welchen Reichtum es bei ihrem Coup ging, war er nicht mehr zu bremsen. Er erging sich in alle möglichen Überlegungen, wie er und Marcel in den Besitz dieser Urkunde gelangen konnten. Am Schluss kamen sie beide überein, dass sie am Besten die jüngste Tochter Emma entführen wollten...
_______________________
Zur gleichen Zeit im Lager der Wittichs feiern diese mit den Sinti und Roma ein rauschendes Zigeunerfest.
Als Ludolf seiner Familie mitgeteilt hatte, wie gut seine Vorbereitungen für den späteren Verkauf auf dem Pfifferfest gelaufen sind, freuten sich alle sehr darüber. Nur Emma war in ihren Gedanken wieder ganz woanders.
Nachdem Großmutter anstelle von Gunter, wie versprochen, über die Geschichte der Pfiffer und die Rappoltstein vorgelesen hatte und Maralda ganz begeistert davon sprach, dass ihre Zigeunersprache bereits im Mittelalter gesprochen wurde, saß Emma danach wieder für sich alleine und sinnierte vor sich hin.
Da fordert Wilhelm seine Schwester Maria auf: „Komm, lass uns mit den anderen tanzen!“
Beide schlossen sich dem bunten Treiben der Sinti an und tanzten Hände klatschend in den Reigen der Zigeuner. Emma starrte indessen ins Feuer und ließ ihre Gedanken auf Wanderschaft gehen.
„Willst du mit mir tanzen, Emma?“, hört sie jemanden fragen. Es war Marco, der Bruder von Maralda Steinhaus, der sie aus ihren Träumen riss.
„Tanzen? Ja, ich möchte Tanzen, den ganzen Tag tanzen, nur tanzen möchte ich jetzt!“
Abrupt steht Emma vom Feuer auf und fängt an, auf ihre eigene Art und Weise zu tanzen. Ihre Arme strecken sich gen Himmel und halten dabei ihre Hände, wie zum Gebet über ihrem Kopf verschlungen. Sie drehte sich nun mit grazilen Körperbewegungen im Kreise und ihre Hüften schwingen rhythmisch zur Gitarrenmusik. Ein extra Trommelwirbel ist zu hören.
Wie verzückt tanzte Emma über die Wiesenfläche dahin, als sei die Welt um sie herum verschwunden. Alle Augen der anwesenden Sippen sind nur noch auf sie gerichtet.
„Ja Emma, tanze, du bist eine wahre Zigeunerin, tanze weiter!”, rufen die Zuschauer ihr aufmunternd zu.
Und Emma tanzte wie wild vor sich hin. Sie tanzte sich sprichwörtlich in Extase.
Marco versuchte mit Emma tänzerisch Schritt zu halten, doch mehr als ein paar unrhythmische Bewegungen brachte er nicht zustande. Dennoch folgte er ihr auf Schritt und Tritt und umwarb sie mit seinen männlichen Signalen. Als Marco jedoch Emma während ihres Tanzes zu küssen versuchte, brach sie ihren Tanz abrupt ab, und gibt Marco eine schallende Ohrfeige.
„He lass das, ich bin bereits vergeben!“ Bei diesen Worten blitzten und funkelten Emmas Augen wie eine Furie.
Marco hält diesem Blick nicht lange stand und begibt sich beschämt zurück in die Reihen seiner Sippe. Maralda empfängt ihn dort und sagte tröstend zu ihrem Bruder: „Mach dir nichts draus!“
Maria hatte das Ganze aus der Nähe mitgehört und blickt Emma ungläubig an. Was hat meine Schwester da gerade gesagt, sie ist bereits vergeben?
Gegen Spätnachmittag neigte sich das Zigeunerfest seinem Ende zu. Die einzelnen Sippen kehrten zu ihren jeweiligen Lagerplätzen zurück.
Es dunkelte allmählich und die Nacht brach herein. Ludolf und Wilhelm räumten die Spuren des Festes beiseite und Großmutter Notburga sorgte für das Abendessen. Es war noch reichlich Fleisch von dem Hammel übrig geblieben.
Emma und Maria sitzen nebeneinander am Lagerfeuer, wobei Maria ihre Schwester fragend von der Seite her ansieht.
„Sag mal Emma, verschweigst du mir da was?“
„Was meinst du?“
„Weißt du nicht mehr, was du zu Marco gesagt hattest, als er dich zu küssen versuchte?“
„Was habe ich denn gesagt?“, fragt Emma nichts wissend zurück.
„Du hast gesagt, dass du bereits vergeben bist!“
„Das soll ich gesagt haben? Davon weiß ich nichts!“
„Bisher haben wir über alles miteinander reden können, warum verschweigst du mir, dass du einen Freund hast. Wie heißt er eigentlich dein Liebster, kenne ich ihn?“
„Ach, das hab ich do nur so dahin gesagt, damit Marco nicht weiter versucht mir nachzustellen!“
„Das glaube ich dir nicht, das war Ernst gemeint! Ich kenne dich zu gut, als das ich mich da irren könnte. Also, wie heißt er?“
„Na gut, dir sag ich`s. Ich habe da im letzten Jahr jemanden kennen gelernt, der heißt Frederik!“
„Wo hast du ihn denn kennen gelernt?“, will Maria neugierig wissen.
„Hier in Ribeauvillè, im letzten Jahr. Ich weiß aber nicht, ob er sich noch an mich erinnern wird! Wir sind ja dann auch über Nacht aufgebrochen und nach Österreich gefahren. Ich konnte mich nicht einmal von Frederik verabschieden und ihm sagen, wann ich wieder komme. Es ist ja auch schon sehr lange her. Er wird mich vergessen haben. Nur ich denke die ganz Zeit an ihn, er will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen!“
„Habt ihr Euch denn geküsst?“
„Ja, es war das erste Mal, dass ich einen Mann geküsst habe!“
„Oh, dann bist du ja richtig verliebt. Wie schön!“
Maria nimmt ihre Schwester in den Arm und streichelt ihr übers Haar.
„Vielleicht siehst du ihn ja in diesem Jahr wieder!“, sagt sie zu ihrer Schwester, die sie weiter umarmt hält.
„Ich hoffe das sehr!“, gibt Emma ihr zur Antwort. „Aber nichts den Eltern erzählen, versprichst du mir das?“
„Ja, das verspreche ich dir, es bleibt unser Geheimnis!“
„Na, was habt ihr da zu tuscheln, ihr Beiden? Ihr spracht gerade von einem Geheimnis!“ Es war ihr Bruder Wilhelm, der gerade hinzugekommen war, als Maria ihrer Schwester Emma versprach, dass sie ihr Geheimnis wahren wollte.
„Wollt ihr mich nicht einweihen, von welchem Geheimnis ihr da sprecht?“
Da gibt Emma, Wilhelm zur Antwort: „Es gibt kein Geheimnis, wir sprachen nur von gestern, wo uns Opa über die Geschichte der Rappoltsteinern und unserer Sippe aufgeklärt hatte. Aber das ist ja auch ein großes Geheimnis, stimmts lieber Bruder Wilhelm?“
Emma schaute ihren Bruder dabei schelmisch an, um herauszufinden, ob Wilhelm diese Geschichte geschluckt hatte.
„Ja“, sagt dieser, „mir geht die Geschichte auch nicht mehr aus dem Kopf, aber das ist jetzt Nebensache. Die Hauptsache ist, wir fahren morgen Früh in die Stadt und bauen dort unseren Stand auf, dazu müssen wir alle Hände zur Verfügung haben. Eine Frau Agatha von Urslingen hilft uns mit einem Leiterwagen aus, den wir bei ihr noch abholen müssen. Also legt euch rechtzeitig zum schlafen, damit ihr morgen Früh frisch und munter seid!“
Während die Zigeunersippen im Forèt Domaniale de Marckolsheim noch fröhlich feierten, sitzen Raoul und Marcel Poschinger nach wie vor im Aubergè du Rhin, und saufen eine Flasche Rouge nach der anderen.
„Also, ich sage dir, die Besitzurkunde wird unsere!“; lallt Marcel und prostete seinem Freund Raoul mit einer halb vollen Flasche Wein zu. „Ich kenne nämlich ein ganz hohes Tier hier in der Stadt Ribeauvillè. Der wird uns ganz bestimm behilflich sein!“
„Was, noch mit einer dritten Person teilen?“, meinte Raoul.
„Halt`s Maul, Raoul, du hast keine Ahnung. Der kriegt natürlich nichts. Ich habe den Mann in der Hand. Und, wenn der nicht so spurt, wie ich will, dann lasse ich ihn auffliegen!“
„Na, dann ist`s gut. Ich dachte schon, wir müssten mit noch jemandem teilen!“
„Ach was, der kriegt nix!“
Marcel war inzwischen richtig gesprächig geworden, sodass einzelne Fetzen ihres Gesprächs auch an den Nachbartischen vernommen wurden. Einige blickten neugierig herüber.
„Wir brauchen noch unbedingt ein Versteck, wo wir die Kleine verschwinden lassen können!“, sagte Raoul etwas leiser und nimmt einen tüchtigen Schluck aus seiner Flasche.
„Das lasse mal meine Sorge sein! Madame haben Sie zwei Zimmer für uns frei, la Chambre d`hotèl?“
Die Wirtin des Etablissements kommt zurück an den Tisch und sagt:
„Ich habe sogar mehrere Zimmer im Haus, die alle nach hinten hinaus gelegen sind, Monsieurs, dort sind Sie total ungestört!“ Die Wirtin wusste sich natürlich einen Reim auf das Gehörte zu machen. „Wie lange wollen die Herren denn hier im Aubergè du Rhin logieren?“
„Solange es uns gefällt und es uns hier bei Ihnen, und in diesem Kaff nicht zu langweilig wird!“, lachte Marcel laut.
„Möchten die Herren denn noch etwas trinken?“, fragt die Wirtin, ohne auf die Bemerkung von Marcel Poschinger einzugehen.
„Bringen Sie uns noch zwei Flaschen von diesem Rouuuuge“, lallte Marcel Poschinger, „wir nehmen zwei Zimmer!“....
Fortsetzung ... folgt und steht auch im Buch.