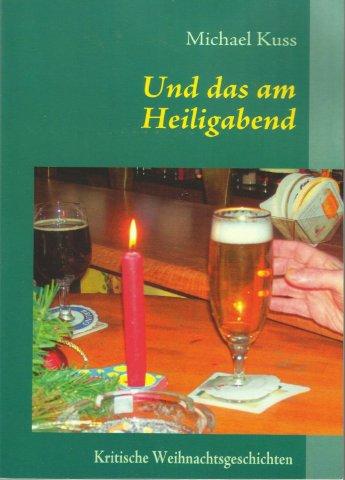
UND DAS AM HEILIGABEND.
Sie hatte mich überhaupt nicht angebettelt, hatte kein Wort gesprochen. Sie hockte nur ängstlich und unterwürfig in die Ecke gekauert. Als wollte sie sich mehr vor den Menschen schützen als vor der kalten Nässe.
Der Wind peitschte den Schneeregen an diesem Vorweihnachtstag durch die Straßen bis in den kleinsten Hauswinkel hinein. Nur den Engeln und den Stofftieren in den auf Weihnachten getrimmten Schaufenstern schien der trübe und nasskalte Dezembertag nichts auszumachen. Tapfer blies der Posaunenchor der Heilsarmee gegen die Eilenden an, die wie Ameisen auf den Rolltreppen herumwieselten. Ein Heilsbringer schrie in die Menge: „Und es begab sich zu der Zeit, dass die Jungfrau gebären sollte, aber es war kein Platz in der Herberge...!“ Er erntete ein müdes Lächeln. Nur wenige Neugierige waren mitleidig oder amüsiert, vereinzelt auch mit andächtigem Gesichtsausdruck stehengeblieben. Noch drei Tage bis Heiligabend! Da gab’s eine Menge anderer Dinge zu erledigen, als sich mit Bibelsprüchen zu beschäftigen.
Zu Hause in meiner Straße war ich dann an ihr vorbei gehastet. Wie man heutzutage aus Gewohnheit, oft auch aus versteckter oder offener Abscheu vorbeigeht. Einfach nicht mehr beachten! Sie haben überhandgenommen! Sie fallen lästig! Und sie stören mein Gleichgewicht! Wir haben eigene Sorgen. Außerdem kann man die Bedürftigen nicht mehr von den Berufsschmarotzern unterscheiden.
Im Vorbeigehen trafen sich unsere Blicke. Warum muss ich Menschen auch immer in die Augen schauen? Wann gewöhne ich mir endlich diesen unverbindlich-neutralen Guck-an-mir-vorbei-Blick an?
Also schaute ich ihr in die Augen, und dabei erwischte mich der Schmerz. Ein Schmerz, dessen Ursprung auch der beste Mediziner nicht lokalisieren kann. Ich löste den Blick und sah in die andere Richtung. Beschleunigte meine Schritte. Blickte Hilfe suchend auf meine Uhr. Schaute grimmig zum Himmel. Ja, ich begann sogar leicht zu hinken. Entschuldigung, aber ich habe meine eigenen Wehwehchen! Kann mich nicht auch noch um Obdachlose und Gestrandete kümmern. Die Stadt ist voll mit Verlierern.
Es half nichts. Kaum um die Ecke, hielt ich erschrocken an. Ich schwankte zwischen eiliger Flucht und verschämter Rückkehr. Der Ausdruck ihrer Augen hatte mich erfasst! Lag darin Angst? Oder fatalistische Ergebenheit? Oder ein Fünkchen Hoffnung? Augen eines Menschen, der jeden Moment damit rechnet, mit Worten oder einem Knüppel geprügelt zu werden. Wie ein heruntergekommener Straßenhund, der zusammengekauert, unterwürfig und schweigend den Schwanz eingezogen hat, und dessen Augen fragen: „Kommt jetzt der nächste Fußtritt, der nächste Schmerz?“
Meine Fantasie schlug Purzelbäume. Ich war aufgewühlt und verunsichert. Das vermaledeite Weihnachtsfest mit seiner erpresserischen Gefühlsduselei! In der Großstadt noch aufdringlicher als irgendwo auf dem Land. Als wenn ICH etwas an den Ungerechtigkeiten der Welt ändern könnte?! Habe ich nicht ein Recht darauf, wenigstens an Weihnachten Ruhe und Frieden zu haben? Ruhe für Menschen wie mich, die sich jeden Tag neu abrackern müssen, um einigermaßen die Balance und das eigene Schiffchen über Wasser zu halten. Bleibt da noch Zeit, sich um Schiffbrüchige zu kümmern?
So gelangweilt wie möglich schielte ich auffällig unauffällig um die Ecke. Keiner meiner Nachbarn und Hausmitbewohner durfte sehen, wie ich für eine verwahrloste Frau in einer nassen Straßennische Interesse zeige. Nicht auszudenken, diese Peinlichkeit, wenn die Nachbarn heimlich tuscheln oder gar Intrigen gegen mich spinnen würden. In unserer Straße ist die Wohlanständigkeit zu Hause. Nicht nur an Weihnachten, aber dann ganz besonders!
Und dieses Bündel Lumpen dort in der Ecke, diese aufgedunsene Alte mit dem dicken, schwammigen Bauch und den strähnigen Haaren, die vielleicht vor wenigen Monaten noch bessere Zeiten gesehen hatte, sie gehörte in ein Asyl oder in die Klapsmühle oder sonst wohin. Aber doch nicht in unsere saubere Straße, die bisher von großer Kriminalität und sichtbarer Armut gottlob verschont geblieben war.
Wenn sie wenigstens nicht so provozierend öffentlich da herumliegen würde! Weiter hinten, in der Hof-Ecke zwischen den Mülltonnen, dort wäre sie fast unsichtbar und wohl auch besser gegen den Wind geschützt. Sie sollte wenigstens auf die Anwohner Rücksicht nehmen, wenn sie sich schon hier ungefragt niederlässt.
Und warum ruft denn niemand die Sozialfürsorge oder die Polizei an und lässt die Frau irgendwohin transportieren? Da gibt es doch sicher irgendwelche Stellen, die sich um so etwas kümmern?!
Heime! Bahnhofsmissionen! Essenausgabestellen! Hinterhöfe! U-Bahnschächte! Aber doch nicht hier mitten auf der Straße der braven Bürger und kleinen Geschäfte. Die letzten privaten Lädchen können sich sowieso kaum über Wasser halten; wie sieht das aus, wenn sich jetzt auch noch Stadtstreicher hier tummeln? Als liberal denkender Mensch muss man so etwas doch neutral von beiden Seiten betrachten!
Meine Kollegin Lilo, sie ist in der Lokalredaktion für Reportagen über Straßenkriminalität, Drogen und Prostitution zuständig, antwortete mir: „Stell’ dich nicht so an! So eine einzelne Pennerin ist doch kaum der Rede wert! Schau dir einmal die Gegend um den Zoo oder die Herumtreiber am Ostbahnhof an, da würden dir die Augen aufgehen!“
Und unser Kollege Rudolf, der als rasender Stadtreporter auf Polizeirevieren und in Gerichtssälen ein und aus geht, hat kurz von seinem Computer hochgeschaut und noch eins draufgegeben: „Mensch, wer geht schon freiwillig in ein Obdachlosenasyl? Weißt du, wie’s da drinnen zugeht? Dagegen ist jede lausige Hinterhofecke das Paradies!“
Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Überhaupt, was soll ich mit solchen Floskeln?! Ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion, bin für gestiegene Aktienkurse und gefallene Manager zuständig, nicht für gefallene Mädchen! Der Stress auf der Arbeit und der Kampf um die täglichen Brötchen fordert doch für jeden von uns Tribut. Sonst kann ich morgen arbeitslos sein und erst auf dem Sozialamt und danach vielleicht auf der Straße enden?! Gott behüte mich vor solchen Höllenträumen!
Die Alte!? Ist sie Fünfundzwanzig oder Fünfundfünfzig? Ein ausrangierter Jahrgang in der sozialen Gosse ist schlecht einzuschätzen. Haare wie ein alter Besen im Müll. Ungewaschen das ausgemergelte, graue und mangelhaft durchblutete Gesicht. Eine kaum verkrustete Wunde über dem Mund. Die Backenknochen unter den wie tot scheinenden Augenhöhlen lassen an Magengeschwüre denken. Ein Pelz-Jäckchen aus besseren Zeiten spannt sich um den aufgedunsenen Bauch. Darüber ein ausgefranster Wickelrock. Das gerissene Oberleder der Schuhe von den Sohlen getrennt. Die Sohlen offen und hässlich wie das Maul einer Kröte. Keine Strümpfe. Nur Mullbinden. Aus dem Mull kroch der Ekel. Daneben zwei pralle Plastikbeutel und eine schmuddelige Reisetasche mit einem Stück Kordel als Griff. Aus der Tasche quollen verschmutzte nasse textile Habseligkeiten zum Erbarmen. Den Schönheitspreis für eine Vogelscheuche könnte sie gewinnen! Wie tief kann ein Mensch eigentlich sinken?
Aber hat nicht jeder sein Schicksal selbst in der Hand? Ich kann es nicht mehr hören, dieses politische Gesülze von der staatlichen Sozialverantwortung; es gibt auch so etwas wie Eigenverantwortung! Nur Schwache werden haltlos; das hat es schon immer gegeben!
Trotzdem überlegte ich: Soll ich der Stadtstreicherin etwas schenken? Damit sie zwei Tage vor Heiligabend in Selbstversunkenheit wenigstens blöde vor sich hin grinsen und einen Schokoriegel genießen kann? Was soll ich sonst tun? Ich kann das Elend dieser Welt nicht lösen, höchstens hin und wieder lindern. Schließlich hat man ja auch so etwas wie ein Gewissen.
Ich stellte meinen Einkaufskorb auf das Kopfsteinpflaster. Mit abgehangenem Pamplona-Schinken und würzigem Käse hatte ich für die Feiertage vorgesorgt. Vorsicht, der Champagner darf nicht in Scherben gehen! Für Victor, meinen Freund mit den treuen Augen Hundefutter vom Feinsten. Zwei neue CDs und Knusperzeug, was man so für die Feiertage braucht. Spitzenunterwäsche und eine Halskette für Barbara. Das Leben wird härter, aber noch können wir’s uns leisten.
Ich wollte dem Elendsbündel den Schokoriegel schnell und möglichst unbemerkt zustecken. Ganz beiläufig, wie man einem Hund einen Knochen oder einem Straßenmusikanten eine Münze hinwirft. Mit einer lässigen Mischung aus Großzügigkeit, Mitleid und schlecht übertünchter Scham. Wir kennen das ja.
Dann wollte ich schleunigst weitergehen. Ich hatte nämlich gegenüber die ältliche, moralinsauere Verkäuferin im Zeitungskiosk erblickt, Klatschmaul und Intrigantin unserer Nachbarschaft, gefährlicher als jeder Friseurladen.
Schließlich überwand ich mich und reichte, nachdem ich die Straße auf und ab und auch die über mir liegenden Balkone observiert hatte, dem Jammerlappen die Schokolade. Die Frau streckte eine Hand aus; es war eigentlich nur eine Faust, ein knorpeliger Stummel, an dem alle Finger fehlten. Der Stummel zitterte. Die Frau sagte idiotisch zigmal danke. Es war peinlich und ich empfand es als würdelos.
Ich kaufte noch Zigaretten, Brot, zwei Büchsen Wurst, Weintrauben und einen Büchsenöffner, - wir denken ja immer so praktisch, also auch noch einen Büchsenöffner. Die Mummelgestalt nahm es ungläubig und linkisch. Teils ängstlich und abweisend, teils unterwürfig und doch gierig wie ein neurotisches Tier. Verlegen brummelte sie irgendetwas aus einem Mund, der einmal schön und geformt gewesen sein könnte und jetzt nur noch ein Klappergestell voller Zahnlücken umschloss.
Unbeholfen und zittrig werkelte sie mit ihrem Handstummel und dem Büchsenöffner an der Wurstdose herum. Schuldbewusst schaute sie mich von schräg unten an, als müsse sie sich für ihre Ungeschicklichkeit entschuldigen. Schließlich stopfte sie den ganzen Kram in einen ihrer Beutel.
Sie wird sich schon zu helfen wissen, dachte ich und ging in meine Wohnung zurück. Die Wohnung war warm und angenehm. Victor lag im Wintergarten und blinzelte mich an. Ich streichelte ihm das Fell. Dankbar kuschelte er seinen Kopf zwischen meine Hände und zeigte mir seine Liebe.
In den beiden nächsten Tagen sah ich die Frau öfters. Sie schien sich tatsächlich für das Weihnachtsfest unser Viertel als Bleibe ausgesucht zu haben. Ich gab ihr nur wenig Bargeld, (wo hätte sie es denn ausgeben können? In diesem Aufzug kann sie sich doch nirgends sehen lassen). Aber ich gab ihr abgelegte Kleidung, Büchsenkonserven, Schokoriegel, Wein und Tabak. Der Reichtum in ihrer Tasche quoll über. Mein Herz auch. Am liebsten hätte ich mir selbst auf die Schulter geklopft.
Niemand schien die Frau zu vertreiben. Wahrscheinlich hatten die Leute Mitleid. Schließlich war Weihnachten. Die Passage zwischen Hauseingang und Hinterhof wird sie gegen die schlimmste Kälte schützen. Notfalls werde ich ihr noch einen Pulli und eine alte Decke bringen.
Den Tag verbrachten wir bei Freunden im Spreewald. Barbara und ich kamen erst am Heiligabend in das noch immer schmuddelige Berlin zurück. Gegenüber meinem Parkplatz lag der ungepflegte Pummel gekrümmt auf einer Bank. Neben ihren prallen Beuteln stand eine leere Weinflasche. Die Frau röchelte im Halbschlaf und wälzte sich unruhig auf die Seite. Wahrscheinlich vollgesoffen! Na schön, dachte ich, dieses Elend ist ja nur im Suff zu ertragen.
Es schneite nicht mehr. Aber es war kalt und windig. Ich holte aus dem Wagen meine Hundedecke, mit der ich nachts den Motor abdeckte und die Batterie warm hielt, und legte sie über die Schlafende. Ob mein Auto morgen anspringen wird? Die leere Weinflasche tauschte ich gegen eine volle, einen echten Bordeaux. An Weihnachten lasse ich mich nicht lumpen; billigen Fusel wird die Alte das ganze Jahr trinken, an Weihnachten sollte es etwas Besonderes sein. Ich klebte einen Zettel an die Flasche. Auf den Zettel schrieb ich „Fröhliche Weihnachten!“ Barbara gab mir anerkennend einen Kuss auf die Wange und sagte: „Ich liebe dich!“ Ich legte meinen Arm um Barbaras Schultern und spürte ihre Wärme.
Wenig später saßen wir im überhitzten Wohnzimmer und Barbara drosselte die Heizung. Victor lag ausgebreitet und faul vor meinen Füßen. Ich kraulte zärtlich seinen Hals. Barbara streichelte mir liebevoll die Schläfen.
Wir hatten die Kinder angerufen; Jens macht ein Praktikum in New York, Carola studiert in Paris und wollte Weihnachten mit ihrem Freund verbringen. Die Kinder sind unabhängig und nehmen ihre Chancen wahr.
Dann war Muttchen im Seniorenheim mit unserem wöchentlichen Anruf an der Reihe. Dort hatten sie eine tolle Weihnachtsfeier für die alten Leutchen organisiert. Wir hatten frohe Feiertage gewünscht und was man eben sonst noch so am Telefon redet. Alles war ein bisschen langweilig und schon zur Routine geworden.
Eigentlich könnte ich jetzt die Frau von der Straße mal kurz heraufholen! Wenigstens für ein paar Stunden. Sie könnte duschen, geduscht würde sie bestimmt viel anständiger aussehen, frische Wäsche anziehen; Barbara wollte ohnehin abgelegte Klamotten, die einmal sündhaft teuer waren, in die Kleidersammlung geben. Vielleicht Glühwein trinken und zusammen rauchen, essen, und die Frau könnte aus ihrem Leben erzählen, von früher, und wie es denn zu dieser Situation gekommen war, warum sie jetzt, und ausgerechnet an Weihnachten...?!
„Ich brauche nicht viel!“ wird sie sagen. „Ich habe nie viel gewollt. War immer mit wenig zufrieden!“
„Das war Ihr Fehler!“ werde ich antworten. „Sie hätten mehr vom Leben fordern sollen! Wer nicht fordert und immer nur klein beigibt, ist am Ende der Dumme!“
Ich erschrak!
Wenn sie mich wörtlich nimmt? Wenn sie sich bei uns einnistet?! Sich häuslich niederlässt? Ich kenne sie doch überhaupt nicht! Und Barbara kann ich mit diesem verrückten Vorschlag schon gar nicht kommen. Irgendwo hat auch Barbara Grenzen. Weihnachten, gut und schön. Aber ausgerechnet eine Pennerin?
Wir hätten ein Geschenkpaket für ein Waisenhaus herrichten können!? Oder wieder einmal zum Weihnachtsgottesdienst gehen und einen Schein in die Kollekte stecken. Der Pfarrer hätte das Geld schon einem guten Zweck zugeführt.
Ich kann dem wildfremden Lumpenbündel morgen früh doch nicht sagen, also liebes Mädchen, das war’s, und nun Husch-Husch zurück auf die kalte Straße! Vielleicht müsste ich aufs Sozialamt mit ihr rennen? Den Bürokraten lang und breit die Zusammenhänge erklären. Womöglich machen die mich sogar verantwortlich und haftbar wie einen Familienangehörigen! Was man da so hört, wie es auf den Sozialämtern zugeht. Ich würde Zeit verlieren und Ärger haben. Ich habe Arbeit und Ärger genug! In einer Woche ist Redaktionskonferenz. Da wird’s ohnehin heiß und hoch hergehen! Auch an meinem Ast wird gesägt. Ich muss selbst sehen, wo ich bleibe...
Oder die Alte stibitzt mir was? Meine Kamera! Computer! Kassettenrekorder! I-Phone! Was ich doch für meinen Beruf, zum Geldverdienen, für meinen kleinen und überschaubaren Lebensstandard brauche. Mir wurde doch auch nichts geschenkt. Ich musste mich in dem Job erst durchbeißen und so manchen Haken schlagen. Da standen Zuckerbrot und Peitsche vor dem wackeligen Erfolg. Was glauben Sie, wie es bei uns in den Redaktionen zugeht? Von wegen Kollegialität! Wie die Geier, aber mit heuchlerischer Freundlichkeit, wartet da einer auf den beruflichen Tod des anderen.
Und außerdem: Die Nachbarn! Ich muss die zerrissene Alte doch durchs hell erleuchtete Treppenhaus aus falschem Marmor schleusen. Da kommen und gehen immerzu Menschen! Ich lebe doch mit dem ganzen Haus in freundlichem Einvernehmen! Soll ich das denn alles aufs Spiel setzen?! Soll ich mich zum Gespött der Menschen machen? Außerdem wird die Alte stinken, und ganz bestimmt Ungeziefer haben, und was weiß Gott noch alles.
Sie würde wahrscheinlich überhaupt nicht mit mir hochkommen wollen! Sie wird an ihre Straßennischen und Parkbänke gewöhnt sein! Sie wird meine Einladung falsch verstehen und mich entgeistert anschauen. Warum sollte ich also die Frau aus ihrer gewohnten Umgebung reißen und sie unglücklich und verlegen machen?
Ja, das war es! Ich würde sie und mich und Barbara nur in eine peinliche Situation bringen. Unser Leben würde sie irritieren! Meine indiskreten, mit journalistischer Strategie gestellten Fragen würden sie verwirren. Dieses unwürdige Schauspiel durfte ich der Frau nicht antun! Also ließ ich die Schnapsidee fallen…
Als der Fernsehfilm zu Ende war, räumte Barbara den Tisch ab und legte Victor noch ein saftiges Hühnerschenkelchen hin. Er schnupperte daran, stieß es mit der Schnauze zur Seite und sah uns halb vorwurfsvoll, halb verständnislos an. Hatte ich Victor in den letzten Tagen vernachlässigt? Ernähre ich ihn ausgeglichen genug? Ob ich ihm nächste Woche lieber dies oder jenes Futter kaufen und mit Kalzium und frischem Ei anreichern soll? Das eine Futter riecht ja ein bisschen komisch, aber im Fernsehen wird tierisch viel Werbung dafür gemacht. Die erfolgreichsten Züchter würden es ihren Hunden geben, obwohl es ja etwas teurer ist.
Höchste Zeit, unseren Victor, meinen zuverlässigen Freund, diesen klugen, kräftigen Schäferhund auszuführen. Er kannte seine Zeiten. Mit wedelndem Schwanz stand er freudig erregt an der Tür und leckte mir die Hand.
Als ich aus der Haustür trat, sah ich die Blinklichter des Rettungswagens. Gelb und blau leuchteten sie und zuckten wie warnende Sternschnuppen durch die Heilige Nacht. Polizisten und Helfer liefen herum. Zwei weiß gekleidete Männer schoben die Frau auf einer Bahre in das rote Auto.
Irritiert ging ich näher heran. Der Polizist schaute mich an.
„Sie ist tot!“ brummte er.
Dann fragte er mich „Kennen Sie die Frau?“ Seine Stimme hatte sich gehoben und ließ ein bisschen Diensteifer erahnen.
„Nein!“ antwortete ich. Der Kloß in meinem Hals war noch nicht gerutscht. „Ich sah sie nur ein paar Mal hier herumsitzen. Immer wenn ich meinen Hund ausführe. Offensichtlich eine … Wohnsitzlose ...!“ sagte ich pietätvoll. Angesichts des Todes wollte ich nicht ‚Pennerin‚ sagen. „Warum? Was ist passiert?“
„Sie war hochschwanger!“ sagte eine Notärztin, die hinzugekommen war und dem Polizisten Papiere übergab. „Wir mussten gleich hier entbinden. Das Kind konnten wir retten. Es ist schon drüben in der Klinik. Dort war noch ein Platz frei ...!“ Die Ärztin zog die Plastikhandschuhe aus.
„Das arme Gör!“ sagte der Polizist. Er zeigte jetzt ein bisschen Gefühl. Für eine Sekunde war die abgebrühte Beamtenstarre aus seinem Gesicht gewichen.
„Vielleicht wird mal was aus ihm!“ sagte eine Nachbarin, die, wie ich, eigentlich auch nur ihren Hund ausführen wollte. „Sie wohnte früher drüben in der Siedlung!“ erklärte die Nachbarin. „Hatte Pech mit ihrem Kerl! Die schlugen und vertrugen sich. Das ging über Jahre! Bis sie endlich ganz von dem Kerl weg ist, und jetzt das hier, schrecklich! Wie Menschen nur so enden können?!“ Dann fügte sie hinzu: „Und das ausgerechnet am Heiligabend!“
Worauf die Ärztin murmelte: „Auch am Heiligabend wird gestorben!“
Der Polizist verstaute die Papiere und schaltete das Funkgerät ein. Ich hörte Wortfetzen: „Hier Spree 45 an Zentrale: Tote identifiziert! Keine Fremdeinwirkung erkennbar! Natürliche Todesursache! Keine weiteren Untersuchungen nötig! Einsatz abgeschlossen! Zentrale bitte kommen! Ende!“
Auf meinem Weg zurück ins Haus traf ich am Aufzug Herrn und Frau Doktor Habermann, unsere Nachbarn von gegenüber. Sie waren auf dem Weg zur Mitternachtsmesse. Wir grüßten uns freundlich und wünschten gesegnete Feiertage.
Dann gingen wir auf den Balkon und ich legte meinen Arm schützend um Barbaras Schultern. Die Glocken klangen von der Kirche zu uns herüber und luden zur Mitternachtsmesse ein.
Es begann zu schneien. Sanft wie schwerelose Federn schwebten und tänzelten die Schneeflocken vom Himmel und bedeckten die Stadt und alle Spuren.
*